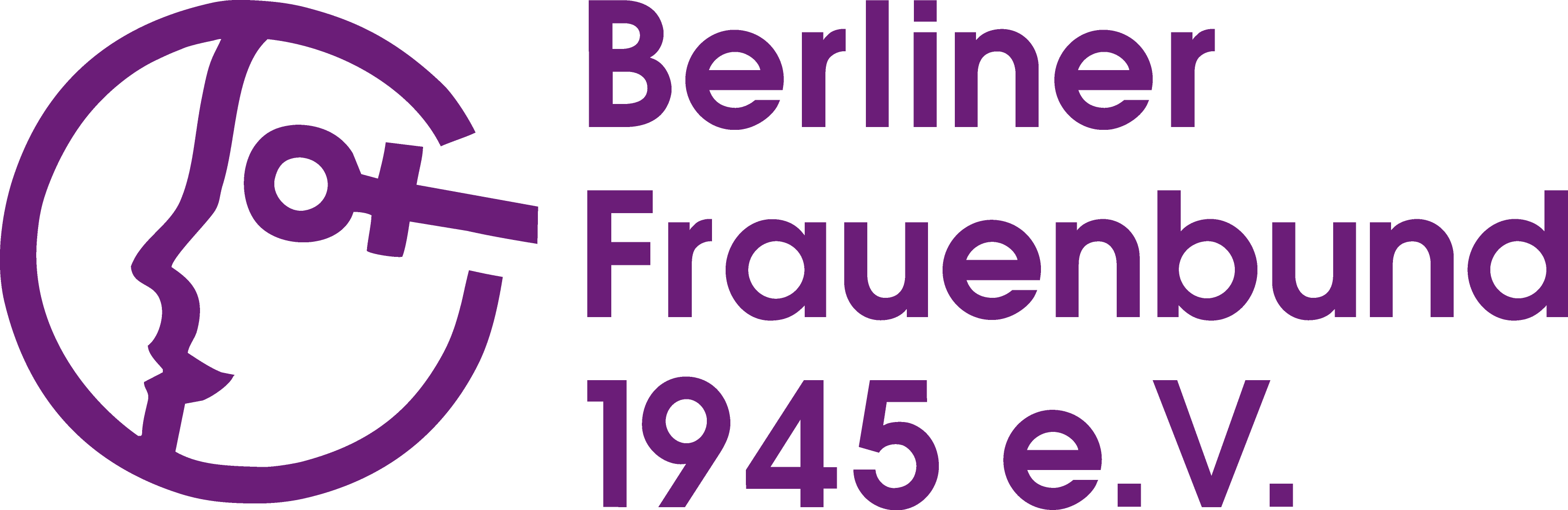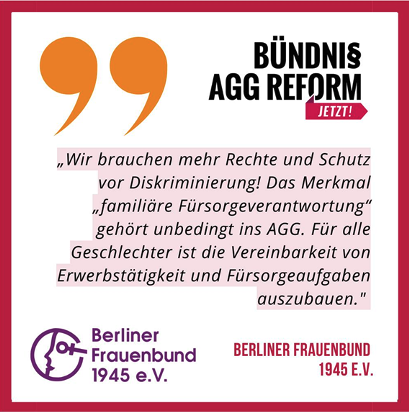Das „Herrenberg-Urteil“ des Bundessozialgerichts und Entscheidungen der Sozialversicherungsträger und das Thema Scheinselbständigkeit bewegen seit 2022 viele Branchen –Volkshoch- und Musikschulen, Fitnesscenter, Physiologiepraxenund eben auch die Branchen Beschäftigung, /Weiter-)Bildung und Beratung. Eine von vielen Konsequenzen aus diesem Urteil ist, viele Einrichtungen gehalten sind, ihre Lehrkräfte in einer Festanstellung zu beschäftigen. Dies ist jedoch finanziell häufig nicht realisierbar.
Auch für viele Frauenvereine ist dies nicht machbar. Aus diesem Grund haben mehrere Vertreterinnen von Frauenvereinen ein Forderungspapier entwickelt, welches an das BMAS geschickt wurde.
Wir unterstützen – auch aus frauenpolitischer Überzeugung – alle Anstrengungen, Scheinselbstständigkeit zu bekämpfen. Gute und faire Arbeit für alle ist uns ein wichtiges Anliegen, für das wir uns auch als Mitglied des AGV 4B einsetzen. Die
im Anschluss an das „Herrenberg-Urteil“ des Bundessozialgerichts (BSG) vom 28.06.2022 – B 12 R 3/20 R –, USK 2022-25 geänderten Prüfungsmaßstäbe der Sozialversicherungsträger und ihre Anwendung in der Prüfpraxis im Rahmen der Statusfeststellung von Erwerbstätigen bergen jedoch erhebliche finanzielle Risiken für gemeinnützige Vereine und deren ehrenamtlich tätige Vorstände, die ein Eingreifen erfordern. Die zuwendungsgeförderte Frauen-, Bildungs-, Beratungs-, Beschäftigungs- und soziale Infrastruktur ist – soweit sie von gemeinnützigen Vereinen mit ehrenamtlich geführten Vorständen getragen wird – akut gefährdet.
Wir fordern:
1.Keine „rückwirkende Anwendung“ der verschärften Prüfpraxis auf Honorar-kräfte, die von gemeinnützigen, ehrenamtlich geführten Vereinen in zuwendungs-finanzierten Frauen-, Bildungs- , Beratungs- oder sonstigen sozialen Projekten beschäftigt werden.
2.Eine klare Regelung („de-minimis-Regelung“), die es diesen Vereinen in Zukunft erlaubt, ohne eine aufwendige individuelle Statusüberprüfung Honorar-kräfte rechtssicher zu beschäftigen, sofern dies mit deren Einverständnis erfolgt und der Einsatz „unterhalb einer zeitlich (z.B. max. x h pro Jahr)und sachlich definierten Grenze“ liegt.
3.Einen Übergangszeitraum bis 2026, in dem für diese Vereine die „neue, geschärfte“ Rechtsauslegung dauerhaft ausgesetzt ist, um eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des freiberuflichen Personaleinsatzes in den Projekten
zu ermöglichen.
4.Nachforderungen der Sozialversicherungsträger infolge der geänderten Rechtsauslegung müssen bei zuwendungsfinanzierten Projekten dieser Vereine
von den Zuwendungsgebern übernommen werden. Die persönliche Haftung der ehrenamtlich tätigen Vereinsvorstände ist in diesen Fällen auszuschließen.
Ausgangslage
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben vor dem Hintergrund
der aktuellen Rechtsprechung des BSG die Beurteilungsmaßstäbe für die Statusprüfung unter anderem von Dozent*innen an sonstigen, auch privaten Bildungseinrichtungen verschärft und sich darauf verständigt,
sie spätestens für Zeiten ab dem 01.07.2023 auch in laufenden Bestandsfällen anzuwenden. Während der Fokus der Öffentlichkeit und der Beteiligten in Politik und Behörden auf Musik- und Volkshochschulen in zumeist kommunaler Trägerschaft gerichtet ist und gemeinsam nach Lösungen gesucht wird, drohen
die Bildungs- und Beratungsangebote zahlreicher gemeinnütziger Vereine in privater Trägerschaft aus dem Blick zu geraten.
Länder und Kommunen – im Land Berlin aber auch bundesweit – nutzen vielfach gemeinnützige Vereine, um relevante gesellschaftspolitische Vorhaben und
Ziele wie z.B. soziale Gerechtigkeit und Bildung zu unterstützen. So beispielsweise auch im Land Berlin mit seinen attraktiven und stark nachgefragten Bildungs- und Beratungsangeboten für Frauen*, die berufliche Um-, Auf- oder Wieder-Einstiege beabsichtigen. In diesem Kontext arbeiten Vereine sowohl mit angestellten, als auch freiberuflich tätigen Mitarbeitenden zusammen. Diese erbringen in der Regel gemäß der in Bewilligungsbescheiden vorgegebenen Honorarordnungen auf der Basis von Honorar- oder Werkverträgen verschiedene Dienstleistungen. Sie führen
z.B. Workshops durch, halten Vorträge, moderieren Veranstaltungen, verfassen
(Fach-)Texte, erstellen Konzepte oder übernehmen grafische Arbeiten.
Es ist zu beobachten, dass die verschärfte Prüfpraxis, infolge des Herrenberg-Urteils, nun auch bei den gemeinnützigen Vereinen zugrunde gelegt werden und
die freien Träger mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen allein gelassen und bestenfalls auf den Rechtsweg verwiesen werden.
Verbandsseitig wird darauf verwiesen, dass jeder Einzelfall gesondert zu prüfen
sei und den Trägern geraten, – auch rückwirkend – für jeden Einzelfall eine rechtliche Einschätzung vorzunehmen. Bestehen danach Zweifel an der Freiberuflichkeit wird empfohlen, Beratung durch Rechtsanwält*innen einzuholen, die sich auf sozialversicherungsrechtliche Statusbeurteilungen spezialisiert haben und gegebenenfalls Rechtsmittel einzulegen. Für die Zukunft wird angeraten, –
im Zweifel – Honorarkräfte nur noch auf der Grundlage eines Arbeitsverhältnisses abhängig zu beschäftigen oder vor Aufnahme der Tätigkeit eine individuelle Statusfeststellung bei der DRV durchführen zu lassen.
Die Vorstandsmitglieder eines gemeinnützigen Trägervereins sind, soweit es um
die statusgemäße Einordnung der zur Aufgabenerfüllung herangezogenen Honorarkräfte in den Projekten geht (auch laufende Bestandsfälle), also mit der Aufgabe konfrontiert, für jeden Einzelfall unter Berücksichtigung der vertraglichen und betrieblichen Verhältnisse vor Ort im Wege einer Gesamtschau eine Vielzahl von Prüfkriterien abzuwägen. Auf eine Unterstützung durch die Zuwendungsgeber können sie – anders als die Volks- und Musikschulen – bislang nicht zählen.
Ungewiss ist, ob die verschärfte Prüfpraxis sowie die daraus folgenden Anforderungen und Konsequenzen bei den betroffenen, häufig kleinen Vereinen flächendeckend überhaupt bekannt sind. Viele dieser Vereine sind nicht verbandlich organisiert und auch angesichts der auf die Musikschulen und Volkshochschulenfokussierten Berichterstattung und der langjährig eingeübten Praxis bislang noch nicht problembewusst.
„Keine Rückwirkung“/ Übergangszeitraum
Die angeratene komplexe, zeitlich aufwendige Einzelfallprüfung überfordert die Verantwortlichen in den vielen kleinen gemeinnützigen Vereinen zeitlich und finanziell. Der gesamte Vorgang ist nicht nur aufwendig, sondern vor allem mit großer Rechtsunsicherheit behaftet. Das Risiko, dass die Einschätzung einer Überprüfung durch die DRV nicht Stand hält und Nachforderungen fällig werden, tragen der Verein und seine Organe. Ebenso wie der Verein die Kosten der empfohlenen Rechtsberatung und Rechtsverfolgung schultern muss.
Die Vereine verfügen in der Regel über geringe Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und sind nicht in der Lage, finanzielle Rücklagen aufzubauen, zumal sich auch die Zuwendungsrichtlinien einschränkend auf die Rücklagenbildung auswirken. Kommt es im Zuge von Statusprüfverfahren zu Nachforderungen der Sozialversicherungs-träger, wird das vielfach das Aus für den Verein mit allen Konsequenzen als Träger ggf. verschiedener Projekte bedeuten. Die „rückwirkende Anwendung“ der verschärften Prüfkriterien auf Honorarkräfte – auch in laufenden Bestandsfällen -, von gemeinnützigen, ehrenamtlich geführten Vereinen muss deshalb abgewendet werden.
Darüber hinaus benötigen diese Vereine ausreichend Zeit, um eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der verschiedenen Projekte durchzuführen und mit den Zuwendungsgebern zu konsentieren. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Arbeitskraft der Projektmitarbeitenden durch die eigentliche Projektarbeit bereits ausgeschöpft ist und das Gros der skizzierten Aufgaben von Vorstands-mitgliedern im Ehrenamt geleistet werden muss. Vor diesem Hintergrund ist ein Übergangszeitraum bis mindestens 2026, in dem für diese Vereine die „neue, geschärfte“ Rechtsauslegung dauerhaft ausgesetzt ist, unabdingbar.
„de minimis-Regelung“
Für die Zukunft braucht es eine eindeutige, einfach zu handhabende Regelung mit objektiv feststellbaren Kriterien, um es gemeinnützigen Vereinen mit zuwendungs-finanzierten Projekten zu ermöglichen, Honorarkräfte rechtssicher und ohne unzumutbaren Prüfaufwand im Verein einsetzen zu können. Unterhalb einer Erheblichkeitsschwelle sollte u.E. auf eine Statusfeststellung verzichtet werden, wenn die Beschäftigung als Honorarkraft mit dem ausdrücklich erklärten Einverständnis der Beschäftigten und in einem zeitlich und sachlich klar definierten Umfang erfolgt („de-minimis-Regelung“).
Freistellung von Nachforderungen und Haftung
Sollte es zu Nachforderungen der Sozialversicherungsträger kommen, kann dies aus den oben genannten Gründen für viele dieser Vereine die Überschuldung und nachfolgend das Aus bedeuten. Verbandsseitig wird empfohlen, im Falle einer nicht abwendbaren Nachforderung, die den Verein finanziell überfordert, den Abschluss einer Stundungs- oder Ratenzahlungsvereinbarung mit der DRV zu versuchen. Diese Möglichkeit dürfte schon aufgrund des engen finanziellen Spielraums in den meisten gemeinnützigen Vereinen ausscheiden. Soweit Nachforderungen aus zuwendungsfinanzierten Projekten, die in enger fachlicher und finanzieller Abstimmung mit den öffentlichen Zuwendungsgebern geplant und durchgeführt werden, resultieren, muss im Notfall der Zuwendungsgeber eintreten. Zugleich sind die ehrenamtlich tätigen Vereinsvorstände in diesen Fällen zumindest für die Vergangenheit von jeglicher Haftung freizustellen.
Wie schwierig es geworden ist, in den genannten Bereichen Vereinsstrukturen aufrecht zu erhalten und ausreichend Menschen zu finden, die auch in Zukunft bereit sind – als Mitglieder in Vereinsvorständen – in ihrer Freizeit diese oft herausfordernden Aufgaben zu stemmen, darf als bekannt vorausgesetzt werden. Es genügt nicht, „das Ehrenamt“ und den uneigennützigen Beitrag der „Ehrenamtler*innen“ zur Stärkung der Daseinsvorsorge, von Partizipation und Demokratie „in Sonntagsreden“ zu würdigen. Verantwortungsträger*innen in Politik und Verwaltung müssen die Rahmenbedingungen so gestalten, dass Verantwortung im Ehrenamt leistbar bleibt. Um ehrenamtliches Engagement zu unterstützen und zu fördern genügt es manchmal schon, die Hürden für diese fragilen Strukturen nicht immer höher zu legen.
gezeichnet:
| Berliner Frauenbund 1945 e.V.Ansbacher Str. 63, 10117 Berlin | |
| Flotte Lotte e.V.Senftenberger Ring 25, 13435 Berlin | |
| LIFE Bildung Umwelt Chancengleichheit e.V.Rheinstr. 45, 12161 Berlin |
Kontakt:
Mechthild Rawert, Vorstandsvorsitzende
Berliner Frauenbund 1945 e.V.
Ansbacher Straße 63, 10777 Berlin
Email: kontakt@berliner-frauenbund.de