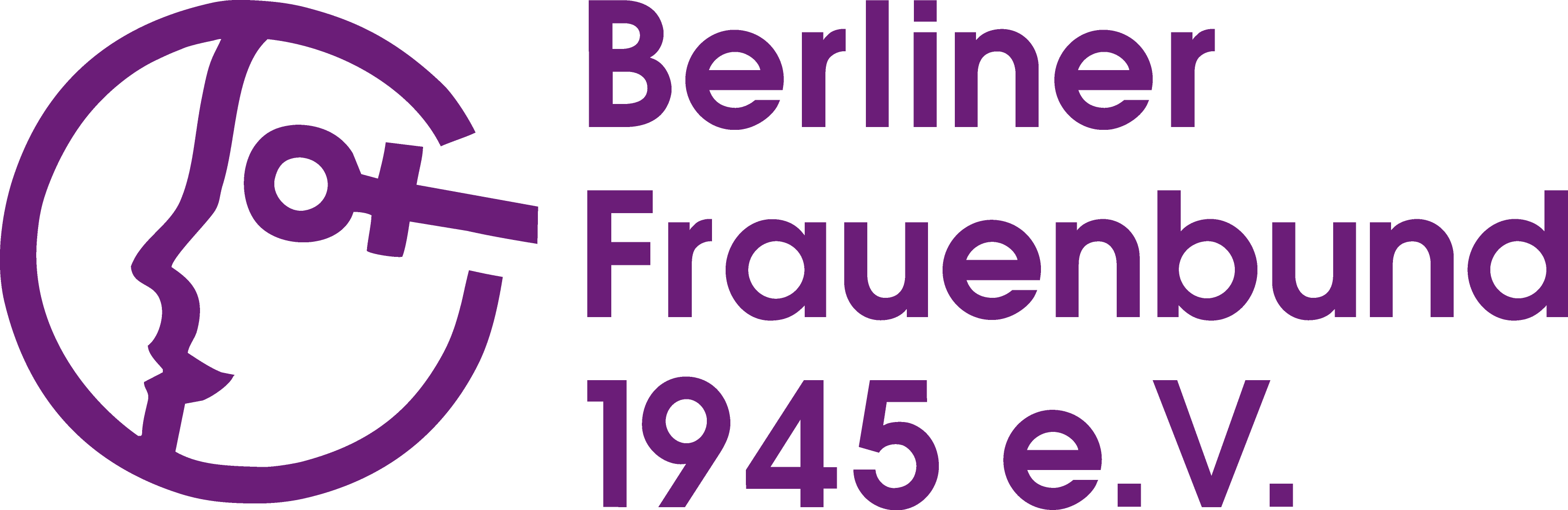Wir fordern: Die Sondervermögen müssen auf Gleichstellung einzahlen!
Der Deutsche Bundestag hat mit seiner Entscheidung vom März 2025 den Weg frei gemacht, ein 500 Mrd – Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur und zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 aufzulegen. Der Gesetzentwurf zur Errichtung des Sondervermögens ermöglicht kreditfinanzierte Rekordinvestitionen in Schulen, Kitas und Krankenhäuser, für moderne Bahnstrecken, Brücken und Straßen, für den Klimaschutz und die Digitalisierung. In die innere und äußere Sicherheit soll massiv investiert werden. Die beschlossenen Sondervermögen stärken auch die Länder und Kommunen.
Das bietet die Chance und ist zugleich Verpflichtung für den Gesetzgeber, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen* und Männern*, von allen Geschlechtern deutlich und nachhaltig voran zu bringen.
Wir fordern daher:
- Die Sondervermögen wie auch die regulären Bundes, Landes- und kommunalen Haushalte müssen durchgängig gleichstellungfördernd gestaltet werden. Die Gesetzgeber aller föderalen Ebenen und alle staatlichen Stellen berücksichtigen bei allen finanzwirksamen Gesetzen und Maßnahmen den Verfassungsauftrag, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern tatsächlich durchzusetzen und bestehende Nachteile zu beseitigen (Art. 3 Abs 2 Satz 2 GG).
- Bei der Haushaltssteuerung ist zwingend eine systematische Analyse der Wirkungen auf die Geschlechterverhältnisse Dies muss insbesondere für die Ausgestaltung des Sondervermögens, den Bundeshaushalt 2025, das Haushaltsbegleitgesetz und die mittelfristige Finanzplanung des Bundes bis 2029 gelten. Gleichstellungsberichte der Bundesregierung, der Landesregierungen und Kommunen belegen: Investitionen sind nicht per se „geschlechterneutral“ sondern können vorhandene Ungleichheiten der Geschlechter zementieren oder sogar verstärken. Sie sind Weckrufe! Es ist sicherzustellen, dass bestehende Ungleichheiten stärker erkannt, benannt und Maßnahmen so ausgestaltet werden, dass sie zum Abbau von Ungleichheit und mehr Geschlechtergerechtigkeit beitragen.
- Verbindlich vorzusehen ist eine Vorabprüfung aller Gesetze, Maßnahmen und Projekte auf ihre Gleichstellungswirkung, die auch eine systematische Analyse der direkten und indirekten Zielgruppen unter intersektionaler Perspektive umfasst. Das muss insbesondere auch für die Novellierung des Vergaberechts gelten. Dazu können die vorhandenen Instrumente (Gleichstellungs-Check) und die im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD für die zukünftige Gesetzgebung vereinbarten Praxis-Checks und Erfolgsindikatoren zur Anwendung kommen.
- Bei der Beteiligung von Betroffenen und Sachverständigen ist zwingend Gleichstellungsexpertise einzubeziehen, wie sie etwa in der Bundesstiftung Gleichstellung vorhanden ist oder durch sie vermittelt werden kann. So kann sicher gestellt werden, dass Gender Mainstreaming und Gender Budgeting nicht zu „gesetzgeberischen Fingerübungen“ verkommen sondern so eingesetzt werden, dass sie Gleichstellung tatsächlich voran bringen.
- Bei der Planung und Umsetzung des Sondervermögens und von Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit sind gleichstellungsbezogene Kriterien zu berücksichtigen und eine geschlechtergerechte Mittelverteilung vorzusehen. Die gesamte Umsetzungsgesetzgebung muss an den bereits bestehenden Gleichstellungszielen des Bundes, der Länder und Kommunen orientiert werden.
- Erkenntnisse, Forderungen und Handlungsempfehlungen aus der Gleichstellungsforschung, den Gleichstellungsberichten und den Alternativberichten der CEDAW–Allianz Deutschland müssen beachtet werden. Eine konsequente Anwendung der gleichstellungsorientierten Haushaltssteuerung muss die verbesserte Ausrichtung der Bundes, der Länder- und kommunalen Haushalte auf die Nachhaltigkeitsziele ermöglichen, und insbesondere die klimapolitischen Zielen sowie die sozialen Nachhaltigkeitsziele berücksichtigen.
Einige Beispiele zum Sondervermögen Infrastruktur:
Bei Investitionen in Schulen, Kitas und Krankenhäuser, in „Betreuungsinfrastruktur“, geht es nicht allein um Gebäude. Die soziale Infrastruktur muss mitbedacht werden. Sie umfasst die Arbeit und Dienstleistungen insbesondere im bezahlten und unbezahlten Care – Sektor. Es reicht nicht, Kitas und Altenheime zu bauen, es müssen parallel mit Mitteln der regulären Haushalte auch die Arbeitsbedingungen (u.a. Entlohnung, Qualifizierung und Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege) und die personelle Ausstattung in der Betreuung und Pflege verbessert werden.
Investitionen in Forschung, Entwicklung und Digitalisierung dürfen sich nicht auf Technologien wie Glasfaserkabel oder Rechenzentren beschränken, sondern müssen zugleich ihre Folgen in den Blick nehmen. Das schließt beispielsweise Themen wie den Schutz vor digitaler Gewalt, die sich insbesondere gegen Frauen* richtet, ein und umfasst eine geschlechtersensible Prüfung von Algorithmen wie Künstlicher Intelligenz. Der Dritte Gleichstellungsbericht „Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten“ enthält weitere wichtige Hinweise und Empfehlungen.
Bei Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur muss beachtet werden, dass Frauen* bzw. vor allem Menschen mit Care-Verantwortung seltener und wenn, dann häufig „kleinere“ Autos fahren. Sie nutzen häufiger den öffentlichen Nahverkehr und legen Wege in Kombination mit Sorgearbeit zurück. Um geschlechtsspezifische Ungleichheiten abzubauen, ist daher ein besonderer Fokus auf den öffentlichen Personennahverkehr und den ländlichen Raum zu legen.
Klimaschutz: Der aktuelle vierte Gleichstellungsbericht „Gleichstellung in der sozial-ökologischen Transformation“ enthält zahlreiche Hinweise und Empfehlungen, die mit dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) aufgegriffen und umgesetzt werden können. Wichtige strukturelle Elemente sind der geforderte Klimapolitische Gender Aktionsplan und eine daran orientierte fachliche Indikatorik.
Last but not least zum Sondervermögen für die Bundeswehr und Sicherheitsausgaben:
Zivil- und Bevölkerungsschutz sowie Verteidigung sind nicht „geschlechtsneutral“. Krisen und Kriege treffen Menschen nach Geschlecht und Care-Verantwortung unterschiedlich hart. Frauen* sind in Notlagen oft mehrfach belastet und stärker gefährdet, bleiben aber bei Planungen und in Entscheidungsprozessen viel zu häufig „außen vor“. Investitionen in diesem Bereich müssen deshalb in Einklang mit der UN-Resolution 1325 auch gendersensible Notfallpläne, barrierefreie Schutzräume und eine stärkere Beteiligung von Frauen* und marginalisierten Gruppen beinhalten.